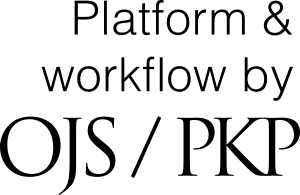De la teoría estética de Schiller a la deconstrucción y a la desmitificación. "Ulrike Maria Stuart" de Elfriede Jelinek y su puesta en escena por Nicolas Stemann
Resumen
Como en la mayoría de los textos de la autora Elfriede Jelinek, las referencias intertextuales son numerosas en la obra teatral Ulrike Maria Stuart. Junto al texto dramático de Schiller Maria Stuart, la obra de Jelinek recupera, parafrasea y reformula fragmentos de los escritos de la RAF (Fracción del Ejército Rojo), así como de publicaciones periodísticas sobre el grupo terrorista. El propósito de este estudio es analizar la función de estas referencias intertextuales en Ulrike Maria Stuart y mostrar cómo a partir de la cita intertextual, la obra teatral de Jelinek desestabiliza y deconstruye la concepción idealista del mundo y del arte expuesta en los textos citados. En el artículo se estudia también la puesta en escena dirigida por Nicolas Stemann, que se estrenó en Hamburgo el 28 de octubre de 2006, y que, de forma similar al texto de Jelinek, entrelaza la visión idealista con la postmoderna del contexto actual.
Descargas
Descarga artículo
Licencia
La Revista de Filología Alemana, para fomentar el intercambio global del conocimiento, facilita el acceso sin restricciones a sus contenidos desde el momento de su publicación en la presente edición electrónica, y por eso es una revista de acceso abierto. Los originales publicados en esta revista son propiedad de la Universidad Complutense de Madrid y es obligatorio citar su procedencia en cualquier reproducción total o parcial. Todos los contenidos se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0). Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario. Puede consultar la versión informativa y el texto legal de la licencia.